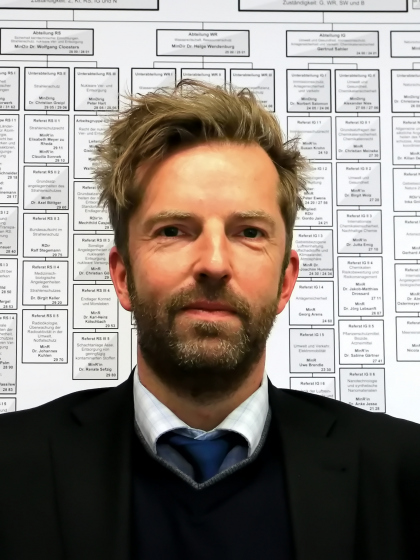Zukunftsforum II.III.2
Z wie Zukunft: von der Zentral- zur Zukunftsabteilung
Zukunftsforum II.III.2
Z wie Zukunft: von der Zentral- zur Zukunftsabteilung
Zentralabteilungen sind in Ministerien und Behörden für wichtige Querschnittsaufgaben wie IT und Personal verantwortlich. Ihre Aufgabe ist es, für gut ausgewähltes und geschultes Personal, optimale Arbeitsbedingungen, funktionierende Technik, einen wirtschaftlichen Einsatz von Steuergeldern und zügige Geschäftsprozesse zu sorgen. So stellen sie die Weichen für einen modernen Staat. Um den wesentlichen Zukunftsthemen gerecht zu werden, müssen sich Z-Abteilungen jedoch neu aufstellen. Das ambitionierte Ziel sollte sein, aus der Zentral- eine Zukunftsabteilung zu machen, die nicht nur auf Stabilität, sondern vor allem auf Fortschritt ausgerichtet ist. Doch welche Voraussetzungen braucht es dafür und wie kann die Transformation gelingen? Der Austausch von erfolgreichen Initiativen und Innovationsprojekten kann hierfür wichtige Impulse liefern.